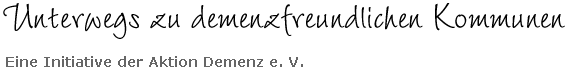Ich wünsche mir für Pirna mehr Angebote, die Normalität und Lebensfreude in den Alltag der Betroffenen bringen.
(Keine) Angst vorm Fliegen!
Im Zug zurück vom Vertiefungsworkshop mit Projekten des Förderprogramms „Menschen mit Demenz in der Kommune“. Novembersonne taucht die vorbeiziehende Landschaft in ein warmes Licht. Die beiden Tage in Bad Nauheim haben wohl nicht nur bei mir ein gutes Gefühl hinterlassen. Wir sind auf dem Weg. Bei fast allen vertretenen Projekten werden die vor Ort begonnenen Anstrengungen nach Auslaufen der Förderung eine Fortsetzung finden. Hier und da wohl nicht mit der gleichen Intensität, mitunter in etwas anderen Gleisen. Doch es wird weitergehen.
Und doch hat sie sich zu mir gesellt, die Wachsflügelfrau. Wir sind miteinander vertraut, seit ich ihr vor Jahren zum ersten Mal begegnet bin. In einem Roman mit eben jenem Titel, der die wahre, tragische Lebensgeschichte der promovierten und habilitierten Juristin Emily Kempin erzählt, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts wagt, das Recht auf Ausübung ihres Berufs für sich zu beanspruchen. Im Kampf gegen Ausgrenzung und Diskriminierung zu Boden gehen – bis zu jenem Zeitpunkt eine mir völlig fremde Vorstellung. Doch seither ist die Wachsflügelfrau Mahnerin an die stets gegebene Möglichkeit des Scheiterns. Du kannst als Person zerbrechen, wenn Du gegen das Bestehende angehst. Ein Projekt kann unterwegs steckenbleiben.
Beim Workshop wurde über die vielen Widrigkeiten gesprochen, die in unseren tagtäglichen Bemühungen lauern. Unnötiges, mitunter zermürbendes Konkurrenzgebaren. Eifersüchteleien anderer Gruppen oder etablierter Organisationen vor Ort. Jenseits aller Larmoyanz haben wir uns über „weiche“ Strategien ausgetauscht, mit deren Hilfe man solchen Reflexen den Wind aus den Segeln nehmen kann; über die Hindernisse, die sich beispielsweise durch Betriebsblindheiten eines traditionellen ehrenamtlichen Engagements auftun können. Aber auch über eigene „Verkopfungen“ – die Tendenz, zu viel zu schnell zu wollen und dabei die Bedürfnisse und Gewohnheiten unserer „Zielgruppen“ schlicht auszublenden.
Stolpersteine, Hindernisse. Nichts, was einen wirklich vom Weg abbringt. Schwieriger wird es, wenn sich herausstellt, dass man diejenigen, die man eigentlich ansprechen möchte, nicht erreicht. Wenn es beispielsweise gelingt, im ländlichen Raum ein Tanzcafé zu schaffen. Da wurde ein besonders schöner Ort gefunden. Man hat Einrichtungen angesprochen, die das Angebot aufgegriffen und ihre Bewohnerinnen und Bewohner zum monatlichen Tanztreff in das Café gebracht haben. Per Ortsnachrichten erging die Einladung auch an sämtliche Haushalte in der Gemeinde. Dank eines rührigen Tanzlehrers und mit Unterstützung von Schülerinnen der örtlichen Altenpflegeschule sind die Tanznachmittage zu einer rundum gelungenen Sache geworden. Die allerdings einen nicht ganz unerheblichen Makel aufweist: Alte Menschen, die im eigenen Zuhause leben, haben sich nicht eingefunden. Nach den geplanten zwölf Tanztreffs beschließen die beteiligten Einrichtungen, derartige Nachmittage künftig im eigenen Haus anzubieten. Erfolg oder Scheitern – brauchbare Kategorien für eine solche Erfahrung?
Es braucht den langen Atem. Vor allem, wenn es darum geht, Menschen zu erreichen, die bislang nur wenig mit der Thematik zu tun hatten. Zu den Veranstaltungen in der Seniorenbegegnungsstätte, in denen das Wort „Demenz“ im Titel auftaucht, haben sich demenziell veränderte Menschen mit ihren Angehörigen eingefunden. Wer sich als außerhalb dieses Kreises stehend versteht, ist weggeblieben. Wie hier die Abschirmwirkung des Labels „Alzheimer“ oder „Demenz“ außer Kraft setzen? Menschen für das Thema aufzuschließen, die nicht in einem engeren Sinn betroffen sind, in den Dunstkreis der Demenzthematik fallen – das ist eine bislang unbewältige Herausforderung.
Auch über die derzeitige Achillesferse so gut wie aller Sozialprojekte haben wir uns ausgetauscht. Das herrschende Denken erweist sich derzeit als bemerkenswert uninspiriert. Allerorten die fixe Idee, das freiwillige Engagement müsse es richten. Immer frisch, liebe Bürgerinnen und Bürger, überall dort in die Bresche springen, wo es im sozialen Bereich klemmt. Ohne jeden Zweifel: es muss darum gehen, dass die Menschen vor Ort Einstellungen entwickeln, die sie ohne großes Aufheben „beiläufige Hilfeleistungen“ für jene Mitbürgerinnen und Mitbürger mittragen lassen, die stärker auf andere verwiesen sind, weil ihr stark alterndes Gehirn íhnen die Dienste versagt. Doch bürgerschaftliches Engagement allein genügt nicht. Es bedarf durchdachter, möglichst kooperativ entwickelter Rahmenbedingungen. Es braucht eine angemessene, auf größere Zeiträume abzielende Ausstattung mit Ressourcen, etwa in Form koordinierender, beratender und begleitender Hauptamtlicher. Nicht den wahlturnustauglichen quick fix, sondern ein Denken und Handeln in den Dimensionen einer bürgerschaftlich getragenen longue durée. Es braucht den Willen, tatsächlich etwas zu verändern. Gemeinsam.
Das größte Anliegen dabei: Wie gelingt es, den Hebel im Denken umzulegen? Eine Teilnehmerin hat es auf den Punkt gebracht: Es fällt relativ leicht, Aktionen zu organisieren und durchzuführen. Neuartige Angebote umzusetzen. Und die Folgen lassen sich trefflich zählen, aufzählen und dokumentieren. Soundsoviele BesucherInnen bei Aktion X. Soundsoviele Interessenten bei Angebot Y. Erfolg! Wie aber stellt sich die Sache dar, wenn wir nach wirklichen Veränderungen bei den Haltungen fragen? Nach einem Umschwung im Denken und in den Einstellungen? Wie schaffen wir das? Und wenn wir es geschafft haben: Wie weisen wir das in unserer ach so aufs exakte Messen versessenen Welt nach?
Da sitzt sie noch immer, die Wachsflügelfrau. Ganz dicht neben mir. Die humanitäre Vision einer gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe aller Menschen, ungeachtet ihres Geschlechts, ihrer sozialen und kulturellen Herkunft, ihrer sexuellen Präferenzen, ihrer Begabungen oder eben ihres Alters und ihrer Beeinträchtigungen – ohne Gewähr. Was also tun? Der Sage nach ist Ikarus abgestürzt, weil er den mittleren Kurs verlassen hat, den ihm der Vater eingeschärft hatte. Weil er zu hoch hinaus wollte. In den vorgegebenen Bahnen verbleiben – das ist keine Option, wenn es bedeutet, in einer Gesellschaft zu leben, die Menschen stigmatisiert, ausgrenzt und vergisst. Vom Versuch Abstand nehmen, in die Welt einzugreifen, weil wir damit scheitern könnten? Das wäre ja noch schöner. Auf die Plätze, Flügel ausbreiten – losfliegen!
Der Workshop in Bad Nauheim fand statt im Rahmen des Förderprogramms, mit dem die Projekte unterstützt werden, die sich auf dieser Plattform vernetzen.
- Anmelden um Kommentare zu schreiben