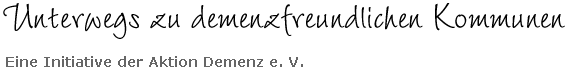Viele Projekte, wie z.B. auch die Kulturpaten, basieren auf ehrenamtlichem Engagement. Es zeigt sich leider immer wieder, dass sich diese Projekte auflösen, wenn es keine professionelle Begleitung und Koordination gibt. Für diese Aufgaben gibt es nach Ablauf der Projektlaufzeit in der Regel keine Finanzierung, so dass viele mühsam aufgebaute Angebote wieder verschwinden und immer neue Projektideen entstehen müssen.
Demenzfreundliche Kommune
Gegenwärtig leben wir in einer Gesellschaft, die ausgesprochen „demenzunfreundlich“ ist. Unfreundlich deshalb, weil unser individuelles wie kollektives Selbstverständnis und Streben von der Vorstellung bestimmt wird, dass soziale Anerkennung durch Leistung, Konkurrenzfähigkeit und Konsum permanent verdient werden muss. Menschen, die in ihrer Leistungs- und Funktionsfähigkeit eingeschränkt sind, mit Gedächtniseinbußen leben müssen oder Hilfe benötigen, werden an den Rand gedrängt und nehmen häufig kaum noch am gemeinschaftlichen Leben teil. Insbesondere Menschen mit Demenz und ihre Familien geraten so in die Isolation oder ziehen sich aus Scham selbst zurück.
Das Thema Demenz wird von der Gesellschaft stillschweigend in ein medizinisch-pharmakologisch-pflegerisches Ghetto geschoben. Die sozialen und kulturellen Aufgaben und auch Chancen, die mit der Demenz einhergehen, werden völlig vernachlässigt.
Wie kann nun eine „demenzfreundliche Kommune“ aussehen?
Wir sind der Meinung, dass weder einzelne Personen noch einzelne Organisationen normativ festlegen können, wie eine solche Kommune – aussehen soll und auf welchem Weg sie zu verwirklichen ist. Vielmehr entstehen Vorschläge dazu in einem Auseinandersetzungsprozess aller Akteure und den Bürgerinnen und Bürgern einschließlich der betroffenen Menschen vor Ort. Was es dazu braucht ist ein geteiltes Verständnis der bestehenden Herausforderungen und auch ein Stück Neu-Erfindung des Gemeinwesens.
Auch der Begriff Kommune trägt mehrere Bedeutungen in sich. Er ist einerseits als räumlich-administrative Verwaltungseinheit (Gemeinden, Städte, Landkreise) zu verstehen, steht andererseits jedoch auch als Sammelbegriff für unterschiedliche Formen sozialer Organisiertheit wie Nachbarschaften oder Zusammenschlüsse (Vereine, Kirchengemeinden, etc.). Dieser Aspekt von Kommune wird von manchen als genossenschaftliche Dimension bezeichnet.
Auch wenn genaue Entwürfe und Ausformulierungen konkreten Praxen vorbehalten bleiben, lassen sich im Vorfeld doch einige Charakteristika einer „demenzfreundlichen Kommune“ beschreiben. Deren Zielsetzung ist in jedem Fall, die Kommune als sozialen Raum so zu gestalten, dass es sich dort für Menschen mit Demenz und ihre Familien gut leben lässt. Hierfür ist nicht zuletzt ihre volle und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft erforderlich. Teilhabe ist ein allgemeines Menschenrecht und verpflichtet das Gemeinwesen u.a., das Leben in der Kommune, die Infrastruktur, Serviceleistungen und weitere Angebote inklusiv und barrierefrei zu gestalten. Dies allein wird jedoch nicht ausreichen, wenn es darum geht eine neue Kultur des Helfens, ein neues Miteinander, „Barrierefreiheit in den Köpfen“ zu schaffen. Im Mittelpunkt steht hier die Aufhebung der einseitigen Wahrnehmung und Stigmatisierung des Themas und der Betroffenen. Es geht darum, einen langfristigen Bewusstseinswandel anzustoßen. So wie wir begonnen haben, Straßen und Häuser physisch barrierefrei zugänglich zu machen, gilt es nunmehr, für Menschen mit Demenz und anderen Einschränkungen den Zugang zur Gesellschaft und zum sozialen Miteinander ‚barrierefrei’ zu gestalten.
Dies ist auch ein Kerngedanke der UN-Behindertenrechtskonvention, die u.a. Menschen mit Demenz unter ihren Schutz stellt. „Behindert sein“ wird nicht als Eigenschaft eines Menschen, sondern als ein Phänomen gesehen, das sich aus der Wechselwirkung zwischen individueller Funktionseinschränkung sowie einstellungs- und umweltbedingten Barrieren ergibt. „Behindert“ sind Betroffene erst, wenn sie auf Barrieren stoßen, die sie an der gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben hindern. Daher fordert die Konvention eine Abkehr von der gesellschaftlichen Fixierung auf Leistung, Gesundheit und Stärke hin zur Achtung der Unterschiedlichkeit und Vielfalt der Individuen.
Abgeleitet werden kann daraus auch, die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz zu achten und ihre Potenziale und Ressourcen wertzuschätzen. Denn diese Menschen tragen, wie alle anderen auch, zur Vielfalt menschlichen Seins und zum kulturellen Reichtum der Gesellschaft bei.
Von den leichten Formen der Verwirrtheit bis zur schweren Demenz im Endstadium brauchen die Betroffenen (und ihre Angehörigen) nicht nur gute medizinische und pflegerische Hilfe. Sie brauchen die Begegnung mit Menschen, Verständnis in ihrer Umwelt - sie brauchen die Erfahrung in ihrer Nachbarschaft, in Städten und Gemeinden noch „dazu zu gehören.“ Und sie benötigen auch die Sorge anderer – nicht in Form paternalistischer Fürsorge, aber in der eines sich selbstverständlichen Kümmerns. Auch hierzu braucht es neue und andere Formen des sozialen Miteinanders und der beiläufigen gegenseitigen Unterstützung. Kommunen, die sich auf diese Weise der Herausforderung Demenz stellen, arbeiten an einer lebenswerteren Zukunft für alle Bürgerinnen und Bürger!
Wenn wir dazu aufrufen, „demenzfreundIiche“ Kommunen – und das heißt auf lange Sicht: menschenfreundliche Kommunen – zu schaffen, steht nicht ein isolierter Ausbau der medizinisch-pflegerischen Versorgungslandschaft oder die Gewährung eines höheren Pflegesatzes zur Debatte. Die Verwirklichung solcher Gemeinwesen erfordert vielmehr längerfristige gesamtgesellschaftliche Veränderungen und die Entwicklung bürgerschaftlicher Solidarität. Gleichberechtigte Teilhabe setzt voraus, dass wir alle bereit sind, alte hinderliche Strukturen ab- und vorhandene Strukturen umzubauen. Jeder von uns, in seinem Privatleben und im öffentlichen Leben, sollte sich mit dem Thema und evtl. bestehenden Ängsten auseinandersetzen, sich in einem selbstverständlichen Umgang mit Menschen mit Demenz üben sowie die damit verbundenen Veränderungen akzeptieren.
Um den dafür erforderlichen Bewusstseinswandel anzuregen und Menschen mit Demenz ein sozial eingebundenes Leben zu ermöglichen, könnten im konkreten Handeln vor Ort beispielsweise folgende Punkte wichtig sein:
- Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit;
- Förderung der Begegnung von Menschen mit und ohne Demenz;
- Entwicklung von Ideen und Formen einer gemeinsamen Verantwortungsübernahme und Zusammenarbeit aller lokalen Akteure sowie der Bürgerinnen und Bürger;
- örtliche Rahmenbedingungen (z.B. Barrierefreiheit, technische Infrastruktur, nachbarschaftliche Hilfen) bedürfnisorientiert gestalten;
- kreative Zugänge durch den Einbezug künstlerischer und kultureller Formen erschließen.
- Anmelden um Kommentare zu schreiben