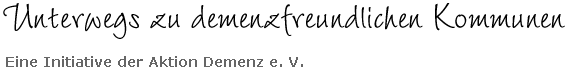[Wir arbeiten]... weiterhin an einem gesunden Bürgermix, d.h. soviel wie möglich Ehrenamtler und so wenig wie notwendig Hauptamtliche.
Dazu gehören
Aus den in den letzten Wochen aufgelaufenen Nachrichten und Pressemeldungen habe ich eine einzige eingesteckt: 95% der Deutschen wollen nicht in ein Heim, so sie einmal alt und pflegebedürftig sind. Dass eine überwältigende Mehrheit so denkt, war mir bekannt. "Neu" ist die per Umfrage ermittelte genaue Prozentzahl.
Was aber sagt dieses „Datum“ aus? Man kann davon ausgehen, dass die Einstellung jener 95% die längst vorgebrachten Argumente und Fakten widerspiegelt, warum Heime für ein gutes Leben trotz gesundheitlicher Beeinträchtigungen keine günstigen Voraussetzungen bieten. Von allen Aspekten, die hier zu nennen sind, schreckt mich am meisten der Gedanke, sich an einen Ort gebunden zu finden, der zwar in dieser Welt, aber an deren Rand gerückt ist.
So sind sie geschaffen worden, die Heime. Jetzt sagen wir: da wollen wir nicht hin. Doch sind Heime nicht deshalb so, wie sie sind, damit die Mehrheit von uns so leben kann, wie sie lebt? Vor allem die mentale Aus- und Abgrenzung der Pflegeheime erlaubt es uns, Alter und Krankheit als Ausnahmezustand zu denken. Nur „im Notfall“ halten wir ihn aus und sobald das eigene Familienmitglied nicht mehr dort verweilt, wenden wir uns wieder ab und kehren in unser vermeintlich normales Leben zurück. In unseren gewohnten, tagtäglichen Wahnsinn des Rennens und Hetzens, mit dem wir uns die fragwürdige Gewissheit verschaffen, dass wir noch dazugehören, noch nicht herausgefallen sind. Alles, um ausblenden zu können, dass das Leben endlich und dass auch das Schwierige und Schwere Leben ist.
Es wird uns auch im eigenen Heim kein gutes Leben im Alter gelingen, falls wir weitermachen wie bisher. Isolierung, Ausgrenzung, schlechte Pflege - das droht auch zu Hause, wenn sich in unseren Köpfen nichts ändert. Deshalb geht es darum, wie wir es anstellen, dass alte Menschen, auch mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, tatsächlich und selbstverständlich Teil des Gemeinwesens sind, keine Randgruppe. Und entsprechende Unterstützung erhalten. Dazu müssen wir als Gesellschaft dem Sorgen einen anderen Platz einräumen. Dafür müssen wir uns öffnen. Verändern. Um womöglich festzustellen, dass die Erfahrungen, die so möglich werden, uns bereichern und wachsen lassen.
In letzter Zeit kommt mir häufig Michael Endes Roman “Momo” in den Sinn. Ich sehe Beppo Straßenkehrer, der sein Stück Straße kehrt. Nun habe ich mein Stück Straße vor Augen, auf das es sich zu konzentrieren gilt: Wir sollten Begebenheiten, Geschichten zusammentragen, die davon erzählen, wie es Schritt für Schritt gelingt, das jeweilige Gemeinwesen mitsamt aller „Daheime“ zu einem Ort zu machen, der ohne Ausgrenzungen auskommt. Wo nicht physische Beeinträchtigungen darüber entscheiden, ob man noch mit dabei sein kann – beim Einkaufen, auf dem Fußballplatz, bei der Aufführung eines Theaterstücks, beim Straßenfest. Wir brauchen Beispiele, wie das Leben im Gemeinwesen Stück für Stück Zugang zu allen Orten findet, an denen alte und kranke Menschen leben. Sie zu Orten werden, an denen wir alle etwas geben und etwas bekommen können. Wo wir lernen. Geschichten, die davon erzählen, wie wir es schaffen, Krankheit und Altern in unserem Leben Raum zu geben. Ich bin überzeugt davon, dass es dabei mehr zu gewinnen als zu verlieren gibt.
Wer teilt seine Geschichte mit mir? Mit uns?
Querella
- Anmelden um Kommentare zu schreiben