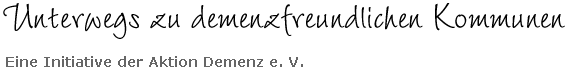Menschen [mit Demenz], die vorher unruhig umherliefen, malten zusammen mit ihren Angehörigen und wurden ganz ruhig. Viele Angehörige waren erstaunt über die Fähigkeiten...
Literatur und Demenz
Von Tanja Schultz
Spätestens durch die Bekanntwerdung der Alzheimererkrankung des Fussballmanagers Rudi Assauers ist das Thema in der ganz breiten Öffentlichkeit angelangt. In den letzten Jahren widmeten sich vermehrt eminente Autoren der deutschsprachigen Literatur dem Thema. Tanja Schulz zeigt anhand konkreter Beispiele, wie wichtig und notwendig eine solche literarisch-künstlerische Auseinandersetzung mit diesem so schwierigen Thema ist.
Jonathan Swift schildert in seinem berühmten Roman Gullivers Reisen aus dem 18.Jahrhundert die Geschichte der unsterblichen Struldbrugs. Lemuel Gulliver hört von den Inselbewohnern, die ab dem 80.Lebensjahr als Tote betrachtet werden. Im hohen Alter vergessen sie alle möglichen Bezeichnungen und Namen und auch alle Gespräche.
Die Beschäftigung mit kognitiven Einbußen im Bereich des Wahrnehmens, Erkennens, Erfassens, Begreifens, Behaltens und Erinnerns alter Menschen, also das, was man in der Regel unter Demenz versteht, reicht also weit zurück. Die Bezeichnung Demenz gibt es seit dem frühen 20.Jahrhundert, wobei die Einordnung als Erkrankung umstritten ist. Im 21.Jahrhundert jedoch ist dieses Phänomen nicht mehr, wie bei Swift, auf eine Insel beschränkbar – durch die demographische Entwicklung erreicht es die Mitte der Gesellschaft.
Für die Angehörigen der Betroffenen ergeben sich dadurch ganz große Herausforderungen: Wie geht man würdevoll mit den geliebten Menschen um, mit denen oftmals kein Kontakt mehr möglich zu sein scheint? Wie wandeln sich alte ungelöste Konflikte? In Deutschland sind mehr als 1 Million Menschen an Alzheimer oder Demenz erkrankt, dadurch, dass zwei Drittel von ihnen von ihren Angehörigen betreut werden, ist die Zahl der Betroffenen noch wesentlich größer. Sehr wahrscheinlich wird das Phänomen in den nächsten Jahren stark zunehmen. Ein öffentliches Problembewusstsein ist überfällig.
Gemeinschaftlicher Trost
Es tut sich was: In der jüngsten Pflegereform wurden höhere Leistungen für die Pflegeklasse 0 beschlossen und die Rahmenbedingungen für Kurzzeitpflege wurden verbessert. Doch mit mehr Geld ist es nicht getan. Der Fall Rudi Assauer zeigt, wie enorm groß das Bedürfnis nach offenen und öffentlichen Gesprächen ist, vor allem weil die Angehörigen neben aller praktischen Hilfe gemeinschaftlichen Trost brauchen, um den Schmerz aushalten zu können, der entsteht, wenn der geliebte Mensch in der Demenz verschwindet. Die Kommunikation mit den Erkrankten ist sehr schwierig. Eine Vielzahl von Diskursen ist nötig, oft redet man über die Erkrankten, weil man nur noch schwerlich oder gar nicht mehr mit ihnen reden kann.
Hier wird das literarische Erzählen unabdingbar. In ihrem Buch Ich habe Alzheimer. Wie sich Krankheit anfühlt protokolliert Stella Braam auf beeindruckende Weise die fortschreitende Demenz ihres Vaters. Es ist eine journalistische Arbeit, die neben dem genauen Protokoll der Krankheit und der Schilderung der intensiven Vater-Tochter-Beziehung (die beiden arbeiten auch zusammen) auch ein sozialpolitisches Statement ist, welches die gesellschaftliche Dimension deutlich macht und Bezug nimmt darauf, wie sich das Bild alter Menschen in unserer Gesellschaft verändert hat. Gab es früher vor allem gemütliche Rentner, sind die sog. Alten von heute sehr vital. Sie reisen, konsumieren und sind eine bevorzugte Zielgruppe der Werbung.
In den letzten Jahren gab es vermehrt journalistische und literarische Auseinandersetzung mit Demenz. Vorherrschend ist zur Zeit das öffentliche Bekenntnis des bekannten Fußballmanagers Rudi Assauer. Bekenntnisse wie dieses rücken das Thema aus dem Dunkel des peinlichen Schweigens in das Licht der Öffentlichkeit – und das ist gut so –, und es hat auch nichts von peinlichen Bekenntnissen Prominenter, die damit Kasse machen wollen. Bei dieser Meldung war die enorme Fallhöhe zu spüren: Wie kann die Demenz jemanden erwischen, der so kernig und sportlich ist wie Rudi Assauer?
Ähnlich war die Reaktion im Jahr 2009, als Tilman Jens’ Buch Demenz. Abschied von meinem Vater über seinen Vater Walter Jens, den berühmten Tübinger Rhetorik-Professor erschien, der durch diverse Fernsehauftritte auch einer breiteren Öffentlichkeit gut bekannt war. Hier geht es weniger um den körperlichen, als den geistigen Verfall. Tilman Jens beschreibt, wie die Demenz die zentrale Identität des – wie es im Text heißt – Wortmenschen Walter Jens erfasst, dem ein Dasein ohne Sprache immer unvorstellbar war. Dabei erzählt Tilman Jens nicht im Präsens sondern im Präteritum – was an die Alten der Insel in Gullivers Reisen erinnert. Der Tod wird hier also erzählerisch vorweg genommen. Der Text ist ein Trauer- oder Abschiedstext und tritt an die Stelle eines persönlich nicht vollzogenen Abschieds. Eine Aussprache findet nicht mehr statt – und es ist nicht nur ein Abschied, sondern auch eine Abrechnung.
Der Text tritt an die Stelle des Dialogs mit demjenigen, welcher der Worte nicht mehr mächtig ist. Es zeigt sich ein Kampf, der zum Teil vom Krankheitsbild gedeckt wird. Die Forschung spricht hier von einer Neigung zum herausfordernden Verhalten. Von hier aus lässt sich eine problematische Szene des Buches betrachten, welche die Frage nach dem Unterschied zwischen einer angemessenen und einer unangemessen Erzählung aufwirft. Gemeint ist die Beschreibung der krankheitsbedingten Inkontinenz des Vaters, welche als Erlebnisbericht aus der Sicht des Vaters dramatisiert wird und sehr ungehörig und bloßstellend wirkt. Aufgrund dieser Schilderung entzündete sich eine öffentliche Debatte darüber, ob man so ganz intime Dinge erzählen darf.
Gratwanderung
Das Beispiel Walter Jens zeigt, welch besondere Gratwanderung diese sog. Bekenntnisliteratur zu leisten hat. Sie muss zwischen Enttabuisierung und Respekt eine Sprache finden – und es ist auffallend, dass diese Texte stets an zwei Zielgruppen adressiert sind: Sie suchen die Gemeinschaft und Öffentlichkeit der Leser und führen zugleich einen intimen Dialog mit dem dementen Angehörigen, der in dieser Form auf persönlicher Ebene nicht mehr möglich ist.
Dies tut auch der österreichische Autor Arno Geiger, er ist dabei jedoch zärtlicher, und diese Zärtlichkeit liegt im Literarischen begründet. Ein Thema sei vorweggenommen: Zur Zeit betrifft die Demenz die Generation, die den Zweiten Weltkrieg und das NS-Regime als Jugendliche miterlebt hat. Die Generation der Väter von Arno Geiger und Tilman Jens kann bald nicht mehr von dieser Zeit erzählen – in einer Kultur, in welcher Zeitzeugenschaft eine so immense Bedeutung hat, wie in der unsrigen, hat das im Zusammenhang mit Demenz eine erhebliche Bedeutung.
Tilman Jens erhebt gegen seinen Vater den Vorwurf einer politischen Demenz, die sich auf die nicht erzählte Geschichte seiner politischen Vergangenheit bezieht. Er nimmt damit Bezug auf den öffentlichen Skandal um die Entdeckung der Parteizugehörigkeit des Vaters, über die nie gesprochen wurde. Geiger erzählt, wie er ein Tagebuch seines Vaters findet, worin dieser die Geschichte seiner Heimkehr aus dem Krieg erzählt, eine Geschichte, die er der Familie noch nie erzählt hatte. Damit wird ein wichtiges Thema von Literatur und Demenz angesprochen: die unerzählten Geschichten. Die politischen und die familiären und das Verschwinden, bzw. die absolute Unzugänglichkeit dieser Geschichten im weiteren Verlauf der Demenz.
Arno Geiger versucht in seinem Buch Der alte König im Exil seinem dementen Vater so nahe wie möglich zu kommen. Das wird vor allem an einem entscheidenden Punkt deutlich: Er erzählt, dass die Familie die Demenz anfangs und dann über sehr lange Zeit nicht als solche erkannt hat, und ob der Rückzugsgefechte, des dumpfen Fernsehguckens etc. in der Familie Spannungen entstanden waren. Dieses Verhalten wurde nicht als Demenz gedeutet, erst nach der Diagnose wird es als Ausdruck von Demenz erkennbar. Die Geschichte mit dem Vater muss also nochmals geschrieben werden, um Vergebung bittend ob der Fehleinschätzung. Das thematisiert Geiger mit Bezug auf einen Satz von Jacques Derrida, dass jedes Schreiben ein Schreiben um Vergebung sei.
Hier zeigt sich in einer besonderen Sprache die grundsätzliche doppelte Adressierung der Texte, die neben dem Dialog mit dem Leser immer auch ein Gespräch mit dem oder der Dementen sind. Geiger betont auch, dass er den Text noch vor dem Tod des Vaters beenden wollte, damit dieser dann noch anwesend sei. Durch diese Struktur kommt es zu einer besonders zärtlichen Erzählweise, so berichtet er zum Beispiel herzlich von dem Talent des Vaters, Ausreden zu erfinden, und schmunzelt über die demente Kreativität: Der Vater erkennt sein eigenes Haus nicht mehr, als die Kinder ihm sagen, dass es sein Haus sei, verneint er es. Dem Hinweis auf das Türschild begegnet er mit dem durchaus logischen Argument, «dass jemand das Schild gestohlen und hier angeschraubt hat».
Radikale Unbehaustheit
Das Thema des Hauses ist zentral für Geiger, es symbolisiert die radikale Unbehaustheit des dementen Menschen. Es ist der Ort der Familienerinnerung, ja fast das Familiengedächtnis, und zugleich hat der demente Vater keinen Zugang mehr dazu. So schreibt denn auch Elfriede Jelinek in ihrem wunderbaren Theatertext Winterreise, der bislang sprachmächtigste Text zum Thema: "…ich bins auch: stumpf, das Leben hat mich abgestumpft, nichts mehr lässt sich in mein Gedächtnis graben, es verabschiedet sich, mein Gedächtnis verabschiedet sich von der Zukunft, die es nicht mehr wird verarbeiten können, aber auch das Ende werde ich nicht mehr erreichen, da ich den Anfang nicht mehr seh…"
Ihre Variation der Winterreise beschreibt eine Wanderschaft, die versucht aus einer radikalen Unbehaustheit und Fremdheit herauszukommen und irgendwo anzukommen. Die Passage, in der sie das Thema hinsichtlich Demenz variiert, ist die umfangreichste, und auch sie nimmt immer wieder Bezug auf das Bild des Hauses. Aber sie bezieht diese Fremdheit, anders als Geiger, auch auf die Sprache, indem sie zeigt, dass Demenz immer auch, in der letzten Konsequenz, ein Verweis aus der Sprache ist: "Vorbei die Zeichen, die ich noch kannte, doch ich erinnere mich nicht, vorbei die Wegmarken, Flursteine, die Signale der Straßenampeln … ich verstehe nichts mehr, bin fort aus mir und nun auch fortgebracht worden von Frau und Kind."
Demenz erscheint hier als Heimweh an sich und als Heimweh nach einem zuverlässigen Referenzsystem. Jelineks Text ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie sehr uns literarische Texte in unserer Auseinandersetzung mit Demenz und Alzheimer – was uns wohl alle ziemlich ängstigt – weiterhelfen können, indem sie wesentliche Aspekte auf den Punkt bringen und benennen.
Tanja Schultz ist Literaturwissenschaftlerin und lebt und arbeitet in Berlin. Sie hat den Text freundlicherweise für die Veröffentlichung auf dieser Plattform freigegeben in Abstimmung mit der Redaktion der Internetseite http://www.sozonline.de. Beiden danken wir herzlich dafür.